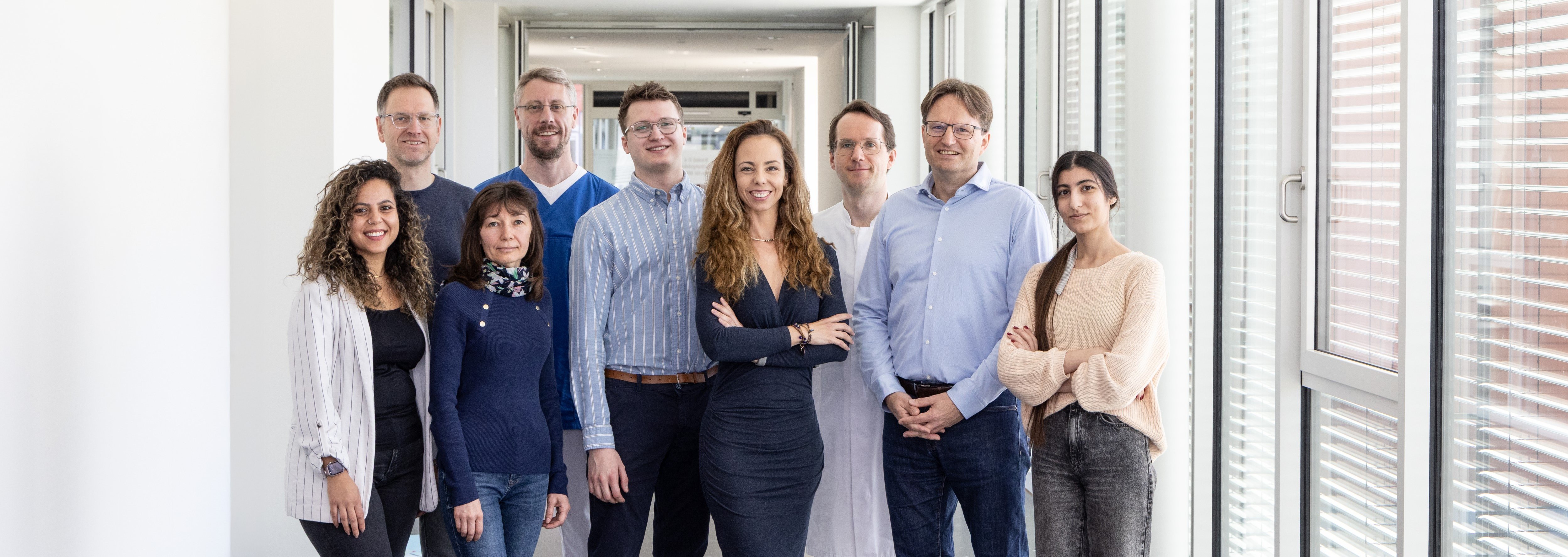
Arbeitsgruppe Prof. Dr. T. Pukrop, Dr. R. Blazquez
Translational Metastasis
-
- Prof. Dr. med. Tobias Pukrop (klinischer Leiter)
- Dr. rer. nat. Raquel Blazquez (wissenschaftliche Leiterin, Laborleiterin)
- Dr. rer. nat. Daniela Sparrer (Post-doc)
- M. Sc. Jessica Alves-de-Lima (PhD Studentin)
- Elena Vollmer (MTA)
- Gunnar Müller (MTA)
- Niklas Schöniger (medizinischer Doktorand)
- Nico Glöckl (medizinischer Doktorand)
- Niloofar Behzadifar (SHK)
-
- PD Dr. med. Daniel Heudobler (Clinician Scientist)
- Dr. med. Florian Lüke (Clinician Scientist)
-
In den nächsten Jahren wird die Anzahl an Krebs-erkrankten Menschen in Deutschland erheblich zunehmen. Erfreulicherweise konnte man bei vielen Krebsarten enorme Behandlungsfortschritte erzielen, dennoch stellt uns eine Metastasierung von lebenswichtigen Organen (z.B. Gehirn, Leber) weiterhin vor große Herausforderungen. In der Vergangenheit ging man davon aus, dass dieser letzte Schritt der Metastasierung sehr spät in der Kaskade erfolgt. Konsequenterweise konzentrierte man sich auf die Krebsentstehung und die Erforschung der ersten Schritte der Metastasierung. Gedanklich stellte somit die frühzeitige Krebs-Behandlung die beste Prophylaxe der Organmetastasierung dar. Aktuelle Erkenntnisse widerlegen aber diese Hypothese und man geht jetzt davon aus, dass die metastatische Kolonisation schon vor der Diagnosestellung beginnt. Bis heute ist es uns aber nicht möglich, die Ansiedelung einzelner metastatischer Zellen in diesen Organen zu detektieren. Somit rückt die metastatische Kolonisation lebenswichtiger Organe plötzlich in den Vordergrund vieler Interessenten und besonders der betroffenen Patienten.
Fragen, wie beispielsweise, welchen Einfluss die Mikroumgebung der unterschiedlichen Organe hat oder welche Eigenschaften eine erfolgreiche Kolonisation der Krebszellen ermöglichen, rücken plötzlich in den Vordergrund. Inwiefern es auch unterschiedliche Kolonisationsarten gibt, ist bisher nur von wenigen untersucht worden. Aktuell geht man aber davon aus, dass es verschiedene Kolonisationsarten gibt, die sich auf die Effektivität der Lokal- und Systemtherapien auswirken könnten. Diese klinisch bedeutsamen Erkenntnisse stehen aber erst am Anfang ihrer Erforschung. Aus diesem Grund beschäftigt sich unsere Arbeitsgruppe seit Jahren mit folgenden Fragen.
- Wie kolonisiert eine Karzinomzelle lebenswichtige Organe?
- Welchen Anteil hat hierbei das betroffene Organ und welchen Anteil die Krebszelle?
- Welche Auswirkung haben die unterschiedlichen Kolonisationsarten auf die Therapie?
Unser Ziel ist es, zukünftig die Vielzahl an Therapiemöglichkeiten so effektiv wie möglich auch bei Patienten mit Organmetastasierung erfolgreicher einsetzen zu können.
Im Detail untersuchen wir die unterschiedlichek Wachstumsmuster (engl. Histological Growth Patterns = HGPs) an der Grenze zum anliegenden Organparenchym (engl. Macro-Metastasis / organ Parenchyma Interface = MMPI). Die HGPs können hierbei mindestens in drei Kategorien unterteilt werden: nicht-infiltrativ, epithelial-infiltrativ und diffus-infiltrativ. Metastasen mit nicht-infiltrativen HGPs sind durch scharf begrenzte Ränder gekennzeichnet und wachsen durch Verdrängung des angrenzenden Gewebes. Im Gegensatz dazu weisen Metastasen mit infiltrativen HGPs keine klare Trennung zwischen dem metastatischen Gewebe und dem Organparenchym auf. Stattdessen finden sich Tumorzellen als Kohorten (epithelial-infiltratives HGP) oder Einzelzellen (diffus-infiltratives HGP) jenseits der Metastasengrenzen. In zwei voneinander unabhängigen Studien konnten wir schon zeigen, dass diese unterschiedlichen Wachstumsmuster Einfluss auf die Überlebenszeit der Patienten haben. Jedoch sind die zugrundeliegenden Faktoren und Mechanismen für die unterschiedlichen HGPs bislang unbekannt.
-
- Der Zusammenhang der Todesursache und des metastatischen Wachstumsmusters am Interface
Eines unserer Projekte untersucht, inwieweit das HGP die Todesursache bestimmt. Im Rahmen eines DFG geförderten Transregio-Projektes (TRR305 – Teilprojekt B03) konnten wir zeigen, dass Metastasen mit nicht-infiltrativen HGPs den intrakraniellen Druck durch Verdrängung von Hirngewebe enorm erhöhen. In Gegensatz dazu sind Metastasen mit infiltrativen HGPs in der Lage, innerhalb des Organs zu erneut zu streuen (sekundäre Disseminierung) und neue Läsionen zu bilden. Dies verursacht die komplette Zerstörung des Organs und führt letztendlich zum Tod.
- Der Zusammenhang der Immunantwort und des metastatischen Wachstumsmusters am Interface
Die Art und Weise, wie Metastasen im Organ wachsen, hat auch Konsequenzen für die Immuninfiltration. Der Zusammenhang zwischen dem HGP und der Immun-Landschaft der Metastase wurde im Rahmen eines DFG geförderten Forschergruppenprojektes (FOR2127 – Teilprojekt B6) untersucht. Hierbei konnten wir zeigen, dass die Zerstörung durch Metastasen mit infiltrativen HGPs zu einem immunsuppressiven Phänotyp führen. Wiederum besitzen Metastasen mit nicht-infiltrativen HGPs einen physikalischen Schutz: die epitheliale Barriere. Diese Barriere verhindert, dass die Metastase von der Organ-eigenen Abwehr (Mikroglia/Astrozyten im Gehirn) angegriffen wird. Dementsprechend besitzt das HGP am MMPI nicht nur einen prognostischen Wert, sondern könnte auch ein prädiktiver Marker für die Therapie von Hirnmetastasen werden.
- Prädiktiver Wert des HGP für die Therapie
Ein wichtiger Teil unserer Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie die Therapie von Hirnmetastasen anhand deren HGPs verbessert werden kann. In aktuellen Projekten wird z.B. untersucht, wie die epitheliale Barriere von Metastasen mit nicht-infiltrativen HGPs durchbrochen werden kann, um die Immuninfiltration zu begünstigen und somit ein besseres Resultat mit immun-modulatorischen Therapien zu erzielen. Hierbei scheint auch die Ferroptose-Sensitivität anhand des HGP ablesbar zu sein. Dieser Ansatz wird aktuell im Rahmen eines BZKF-geförderten Projektes (TLG-PRe-Drug) präklinisch untersucht.
Darüber hinaus streben wir an, die Umerziehung (Re-education) von Makrophagen im metastatischen Milieu zu erzielen, um deren Rolle bei der Bekämpfung der metastatischen Kolonisation zu unterstützen. Hierbei konnten wir bereits mehrere Ansätze (z.B. mittels PI3K Inhibition oder TLR4 Modulation) im Rahmen eines BMBF-geförderten Konsortium-Projektes (MetastaSys – Teilprojekt 3) erfolgreich durchführen. Unser aktuelles DFG-gefördertes Transregio-Projekt (TRR305 – Teilprojekt B03) beschäftigt sich mit TREM2 als potentiellem Makrophagen-Immun-Checkpoint bei Hirnmetastasen.
- Das Kommunikationsnetzwerk einer Metastase
Schließlich interessiert uns, wie die Tumorzellen untereinander und mit den Zellen des angrenzenden Tumormilieus in Abhängigkeit der verschiedenen HGPs kommunizieren. Ein wichtiger Ansatzpunkt um diese Kommunikation zu untersuchen ist das Kalzium-Signaling. Wir haben herausgefunden, dass Damage-Faktoren, die in hoher Konzentration im Tumormilieu vorkommen, Kalziumsignale in unseren Hirnmetastasen-Modellen auslösen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass sich die Charakteristik dieser Signale zwischen Zelllinien mit unterschiedlichen HGPs unterscheidet, was Bestandteil aktueller Forschung ist.
- Der Zusammenhang der Todesursache und des metastatischen Wachstumsmusters am Interface
-
2023
Regensburger Onkologiepreis für eine experimentelle Forschungsarbeit (Dr. Blazquez)2022
Regensburger Onkologiepreis für eine klinische Forschungsarbeit (Dr. Blazquez)2019
Regensburger Onkologiepreis für eine präklinische Forschungsarbeit (Dr. Blazquez)
-
- Blazquez, R., D. Sparrer, J. Sonbol, J. Philipp, F. Schmieder and T. Pukrop (2024). "Organotypic 3D Ex Vivo Co-culture Model of the Macro-metastasis/Organ Parenchyma Interface." Methods Mol Biol 2764: 165-176.
- Adler, O., Y. Zait, N. Cohen, R. Blazquez, H. Doron, L. Monteran, Y. Scharff, T. Shami, D. Mundhe, G. Glehr, A. A. Kanner, S. Horn, V. Yahalom, S. Haferkamp, J. A. Hutchinson, A. Bleckmann, L. Nahary, I. Benhar, S. Yust Katz, T. Pukrop and N. Erez (2023). "Reciprocal interactions between innate immune cells and astrocytes facilitate neuroinflammation and brain metastasis via lipocalin-2." Nat Cancer 4(3): 401-418.
- Blazquez, R., H. N. Chuang, B. Wenske, L. Trigueros, D. Wlochowitz, R. Liguori, F. Ferrazzi, T. Regen, M. A. Proescholdt, V. Rohde, M. J. Riemenschneider, C. Stadelmann, A. Bleckmann, T. Beißbarth, D. van Rossum, U. K. Hanisch and T. Pukrop (2022). "Intralesional TLR4 agonist treatment strengthens the organ defense against colonizing cancer cells in the brain." Oncogene 41(46): 5008-5019.
- Blazquez, R., M. A. Proescholdt, M. Klauser, K. M. Schebesch, C. Doenitz, D. Heudobler, L. Stange, M. J. Riemenschneider, E. Bumes, K. Rosengarth, A. Schicho, N. O. Schmidt, A. Brawanski, T. Pukrop and C. Wendl (2022). "Breakouts-A Radiological Sign of Poor Prognosis in Patients With Brain Metastases." Front Oncol 12: 849880.
- Blazquez, R., E. Rietkötter, B. Wenske, D. Wlochowitz, D. Sparrer, E. Vollmer, G. Müller, J. Seegerer, X. Sun, K. Dettmer, A. Barrantes-Freer, L. Stange, K. Utpatel, A. Bleckmann, H. Treiber, H. Bohnenberger, C. Lenz, M. Schulz, C. Reimelt, C. Hackl, M. Grade, D. Büyüktas, L. Siam, M. Balkenhol, C. Stadelmann, D. Kube, M. P. Krahn, M. A. Proescholdt, M. J. Riemenschneider, M. Evert, P. J. Oefner, C. A. Klein, U. K. Hanisch, C. Binder and T. Pukrop (2020). "LEF1 supports metastatic brain colonization by regulating glutathione metabolism and increasing ROS resistance in breast cancer." Int J Cancer 146(11): 3170-3183.
- Blazquez, R., D. Sparrer, C. Wendl, M. Evert, M. J. Riemenschneider, M. P. Krahn, N. Erez, M. Proescholdt and T. Pukrop (2020). "The macro-metastasis/organ parenchyma interface (MMPI) - A hitherto unnoticed area." Semin Cancer Biol 60: 324-333.
- Doron, H., M. Amer, N. Ershaid, R. Blazquez, O. Shani, T. G. Lahav, N. Cohen, O. Adler, Z. Hakim, S. Pozzi, A. Scomparin, J. Cohen, M. Yassin, L. Monteran, R. Grossman, G. Tsarfaty, C. Luxenburg, R. Satchi-Fainaro, T. Pukrop and N. Erez (2019). "Inflammatory Activation of Astrocytes Facilitates Melanoma Brain Tropism via the CXCL10-CXCR3 Signaling Axis." Cell Rep 28(7): 1785-1798.e1786.
- Blazquez, R., D. Wlochowitz, A. Wolff, S. Seitz, A. Wachter, J. Perera-Bel, A. Bleckmann, T. Beißbarth, G. Salinas, M. J. Riemenschneider, M. Proescholdt, M. Evert, K. Utpatel, L. Siam, B. Schatlo, M. Balkenhol, C. Stadelmann, H. U. Schildhaus, U. Korf, E. Reinz, S. Wiemann, E. Vollmer, M. Schulz, U. Ritter, U. K. Hanisch and T. Pukrop (2018). "PI3K: A master regulator of brain metastasis-promoting macrophages/microglia." Glia 66(11): 2438-2455.
- Schwartz, H., E. Blacher, M. Amer, N. Livneh, L. Abramovitz, A. Klein, D. Ben-Shushan, S. Soffer, R. Blazquez, A. Barrantes-Freer, M. Müller, K. Müller-Decker, R. Stein, G. Tsarfaty, R. Satchi-Fainaro, V. Umansky, T. Pukrop and N. Erez (2016). "Incipient Melanoma Brain Metastases Instigate Astrogliosis and Neuroinflammation." Cancer Res 76(15): 4359-4371.
- Siam, L., A. Bleckmann, H. N. Chaung, A. Mohr, F. Klemm, A. Barrantes-Freer, R. Blazquez, H. A. Wolff, F. Lüke, V. Rohde, C. Stadelmann and T. Pukrop (2015). "The metastatic infiltration at the metastasis/brain parenchyma-interface is very heterogeneous and has a significant impact on survival in a prospective study." Oncotarget 6(30): 29254-29267.
-
- Organ defence during metastatic colonization by shielding macrophages, DFG Transregio 305 Projekt B03
- Translational group for preclinical drug repurposing and target identification in hard-to-treat cancers (BZKF-TLG: PRe-Drug): A preclinical pilot study of ferroptosis-inducing drugs in triple negative breast cancer and lung adenocarcinoma (PRe-Ferro 001), BZKF
- Lipocalin-2-mediated iron metabolism at the crossroad of inflammation and metastatic colonization, ReForM-E Projekt 4
Kontakt
Dr. rer. nat. Raquel Blazquez
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III (Hämatologie und Onkologie)
Am Biopark 9
93053 Regensburg
raquel.blazquez@ukr.de
0941-943 5941
Prof. Dr. med. Tobias Pukrop
Universitätsklinikum Regensburg
Centrum für Translationale Onkologie (CTO) &
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III (Hämatologie und Onkologie)
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg








